Beeindruckend
Jim Elliot - Märtyrer und Vorbild
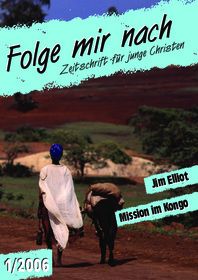
Als Jim Elliot vor fünfzig Jahren, am 8. Januar 1956, im Alter von 29 Jahren zusammen mit vier weiteren Missionaren von Auca-Indianern in Ekuador ermordet wurde, erfüllte sich das Glaubensleben dieses jungen Menschen, der auch uns heute noch viel zu sagen hat. Dieser Rückblick auf sein Leben soll deshalb besonders ein Appell für uns heute sein. Sein Tagebuch vermittelt beeindruckend den Werdegang und die innere Haltung dieses jungen Mannes und ist deshalb Basis dieses Rückblicks.
Jugend für Christus
Philip James Elliot wurde am 8. Oktober 1927 in Portland, Oregon in den USA geboren. Seine Eltern waren überzeugte Christen – sein Vater wirkte als Evangelist – und übten oft Gastfreundschaft an Missionaren. Mit sechs Jahren bekehrte sich Jim zum Herrn. Bei seinen Eltern erlebte er auch Christus als Mittelpunkt von Familie, Gemeinde und dem Einzelnen.
Die Haltung seines Vaters wird in einem Brief an seinen Sohn deutlich: „Ich bin besorgt über jede Sache und jeden Menschen, der Dich auf Deinem Weg zu den ewigen Gütern und an einem gänzlich gottgeweihten Leben hindern könnte“.
Bereits in seiner Zeit auf der High School in Benson begann er seiner Umgebung die Botschaft von Christus zu vermitteln und nutzte seine Zeit zum Bibelstudium und zum Gebet.
Als er 1945 auf das Wheaton College in Illinois kam, fasste er den festen Entschluss, Gott hingegeben zu leben und diesem Lebensmotto alles unterzuordnen. Diszipliniert pflegte er die stille Zeit – und ernährte und trainierte er seinen Körper, obwohl sein Studium ganzen Einsatz forderte. Am Ende des ersten Studienjahres schreibt er in sein Tagebuch: „Es ist ein nützliches Jahr gewesen; ich bin meinem Erlöser nähergerückt und habe Schätze entdeckt in seinem Wort“.
Ich bin besorgt über jede Sache und jeden Menschen, der Dich auf Deinem Weg zu den ewigen Gütern und an einem gänzlich gottgeweihten Leben hindern könnte.
Fred Elliot an seinen Sohn Jim
Weg-Führung nach Ekuador
Schon durch die Kontakte im Elternhaus wurde sein Interesse an Missionsarbeit geweckt. Doch während seines Studiums vertiefte sich sein Eindruck, dass Gott ihn außerhalb der USA benutzen wollte: „In den fremden Ländern gibt es einen Gottesarbeiter auf je 50 000 Menschen, während es in den USA einen auf 500 gibt“. „Der Herr legte mir schwer die Not der noch unerreichten Millionen Innerasiens auf die Seele“. Auch wenn er während dieser Zeit die Zusammenkünfte der Christen in seiner Umgebung besuchte und nach besten Kräften mitwirkte, wurde ihm doch 1948 klar, „dass die allgemeine Zielrichtung meiner missionarischen Arbeit der südamerikanische Urwald“ sein sollte. Dann hörte er durch den Bericht eines Missionars zum ersten Mal von den Aucas (heute Waorani oder Huaorani genannt), die völlig unberührt in den Urwäl dern Ekuadors leb(t)en und die jede Annäherung von Weißen mit Töten beantworteten (bis heute gibt es Stammesfehden mit tödlichem Ausgang, und noch in den achtziger Jahren wurde ein katholischer Priester von den Huaorani ermordet). Auch die benachbarten, friedlicheren Ketschua-Indianer traten in seinen Blickkreis, und so beschloss er am 4. Juli 1950, für 10 Tage in die Stille zu gehen, um Klarheit zu bekommen. Diese gab ihm der Herr durch 2. Mose 23,20. Es sollte noch zwei Jahre dauern, bis er schließlich am 4. Februar 1952 per Schiff nach Ekuador aufbrach, zunächst mit dem Ziel, unter den Ketschua-Indianern zu arbeiten.
Hingabe an den Herrn
Ohne seinen Märtyrertod hätten wir wohl nur wenig von Jim Elliots Tagebüchern erfahren, in denen er ganz persönlich und ohne einen Gedanken an spätere Veröffentlichung zu verschwenden, seine Eindrücke und Erlebnisse notiert hat. Sicher war er auch schon von seinen natürlichen Begabungen her ein außergewöhnlicher Mensch – sprachbegabt, ein guter Dichter (er hat später viele Lieder in der Ketschua-Sprache gedichtet) und auch ein brillanter Denker. Dennoch wird man von dem Geist, den seine Eintragungen atmen, auch als Normalbegabter profitieren. Dabei steht besonders seine unbedingte Hingabe an den Herrn immer wieder voran. Einige sehr persönliche Bitten aus seinem Tagebuch geben einen Eindruck von seinen Empfindungen – die sicher nicht einfach übernommen werden können:
„Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens, gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Gott, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus“ (1948).
„Vater, nimm mein Leben, ja mein Blut, wenn du willst, und verzehre es in deinem Feuer. Ich will es nicht behalten, denn es ist nicht mein, dass ich es für mich behielte. Nimm es Herr, nimm es ganz. Gieß mein Leben aus als eine Opfergabe für die Welt.“ (1948)
Berühmt geworden ist ein Satz, der im Zusammenhang gelesen noch beeindruckender ist:
„Eine der großen Segnungen des Himmels ist, dass wir ihn jetzt schon genießen können – wie es im Epheserbrief beschrieben wird. Der ist kein Tor, der weggibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann“ (1948). Nur wer weiß, was es zu gewinnen gilt, ist bereit, alles andere zu verlieren!
Während seiner Vorbereitung auf die Ausreise kann er schreiben: „Nur das eine weiß ich, dass mein eigenes Leben voll ist, denn ich habe alles getan, was ein junger Mensch nur tun kann, wenigstens dieser junge Mann. Ich bin bereit, vor Jesus hinzutreten“.
Weg mit jeder Bürde!
Wie jeder andere junge Mensch war auch Jim Elliot manchen Verlockungen und Versuchungen ausgesetzt. Er war sich dessen bewusst, wie selbst scheinbar Harmloses den Blick für das Wesentliche verstellen kann. So lehnte er den einträglichen Posten des Geschäftsführers der Studentenzeitung ab, da er seine freie Zeit nicht dafür opfern wollte. „Vater, gib, dass ich mich nicht zersplittere und vergeude in Nebensächlichkeiten, in Dingen, die unwesentlich sind. Lass dein Wort in Kraft auf mich wirken“.
Eine Zeitlang öffnete er sich doch der einen oder anderen Aktivität mit seinen Kommilitonen, aber später schreibt er: „Die Kameradschaft mit der fidelen Clique ist verlockend und sehr amüsant, aber heute Abend merke ich, dass meine Seele dadurch ziemlich abgelenkt wird und von Erregungen erfüllt ist. Es ist nichts Schlimmes – aber eben auch nichts Gutes“.
Manchmal sind es die „kleinen Füchse“, die den Weinberg des Segens behindern: „Schaute in eine Lebensbeschreibung von Wilhelm Farel, einem beachtenswerten Reformator, und flog das Buch bis zum Ende durch. Drei Stunden waren vergangen, als ich mich der Bibel und dem Gebet zuwandte. Ich hoffe, dass wird mir eine Lehre sein, denn erst nach beträchtlichen Schwierigkeiten und besonderer Konzentration konnte ich die Kraft des Wortes langsam wieder spüren“. Auch die Beschäftigung mit nützlicher Literatur – und sicher sind Biographien von treuen Männern und Frauen des Glaubens nützlicher als weltliche Romane – darf die Bibel nicht vom ersten Platz verdrängen.
Dennoch war auch Jim nicht immer obenauf: „Schwierigkeit, aus dem Wort auch nur den kleinsten Zuspruch zu bekommen. Kein Gebetseifer. Wenn ich überhaupt etwas aus der Schrift gewinnen will, muss ich mich zum Bibelstudium sehr zwingen“.
„Heute morgen starkes Gefühl von Nutzlosigkeit. Freude durch Gebet. Ach, lass mich dich erkennen, Herr – lass mich dich schauen, nur einen kurzen Augenblick, wie du thronst in der Herrlichkeit, lass mich darin Ruhe finden trotz all des Verkehrten, das mich hier umbrandet.“
Ob wir nicht alle ein wenig von seinen Erfahrungen und den Konsequenzen lernen sollten?!
Liebe muss warten
Schon während seines Studiums in Wheaton lernte Jim Elliot in den Griechischstunden Elisabeth Howard kennen und nahm Kontakt zu ihr auf. Dabei hielt er seine Gefühle so im Zaum, dass Elisabeth von seinen Zuneigungen zunächst nichts verspürte. Die beiden lernten sich als ernsthafte Christen schätzen („ein ungeheures Gottvertrauen lebt in ihr“) und tauschten sich oft aus. Doch beide waren sich einig, dass die Hingabe an Christus Vorrang hat vor einer Verbindung zueinander. So schenkte er ihr ein Gesangbuch mit dem Hinweis auf ein Lied, das davon spricht, dass kein „Objekt“ (Person oder Sache) dem Herrn übergeordnet sein darf (engl. „Have I An Object, Lord, Below“, Liederbuch „Spiritual Songs“ No. 364, „Hält etwas mich hier unten fest“). Und diese Rangfolge wählten Jim und Elisabeth – freiwillig.
Das bedeutete für beide viel Schmerz: „Vor einer Stunde ist sie fortgefahren. Sich von ihr zu trennen, ist schrecklich. Wie bitter ist Liebe, der man keinen Ausdruck geben darf!“
Als dann sein Plan, nach Ekuador zu gehen, feststand, bedeutete dies weitere Distanz. Aber er war sich völlig sicher, allein gehen zu sollen, und ordnete diesem erkannten Willen Gottes sein eigenes Wollen unter: „Wenn es mein eigener Beschluss gewesen wäre, als Lediger hinauszugehen, dann würde ich meinen Plan bestimmt ändern. Aber der Lenkende ist Gott, Betty. Er weiß: Lieber ginge ich mit Dir zusammen. Doch sein Auftrag ist das höchste“. Das war nicht nur für sie eine harte Schule: „Manchmal packt mich ein an Wahnsinn grenzendes sinnliches Verlangen; nicht immer, Gott sei Dank, aber doch so häufig, dass der Verzicht auf sie um des Werkes willen zu einer harten, brennenden Realität wird. Hierin spüre ich gerade jetzt, mehr denn je, Jesu Forderung: „Wer nicht absagt allem ...“. Ja, ich danke Gott für das Vorrecht, um seinetwillen etwas aufzugeben“.
Gott rief auch Elisabeth zur Missionsarbeit nach Ekuador. Doch erst nach längerem Warten verlobten sie sich am 1. Februar 1953 Wheaton College und heirateten einige Monate später. Ihr erstes Domizil war für mehrere Monate ein 30-qm-Zelt auf einer völlig abgelegenen, gerade erst gegründeten Missionsstation. Im Februar 1955 wurde die Tochter Valerie geboren. Doch die Ehe, die der Herr ihnen erst nach jahrlanger Wartezeit schenkte, sollte nur von kurzer Dauer sein...
Unter den Ketschua-Indianern
Nach dem Eintreffen in Ekuador und dem Erlernen der spanischen Sprache begann Jims eigentlicher Missionseinsatz, den er ohne Bindung an eine Missionsgesellschaft praktizierte: „Es ist eine ganz freie Art von Arbeit – keine Organisation steht hinter einem, man hat nicht einmal einen Briefkopf, der einem das Gefühl gibt, dass man zu etwas ‚gehört‘. Aber es beglückt einen, dass man aufsehen darf zu Gott“. In einem Ketschua-Dorf, Shandia, stürzte sich Jim Elliot in die Arbeit, zu der auch die Führung der Grundschule und die ärztliche Versorgung der Bevölkerung gehörte. Nach einigen Anfangshürden konnte er schon bald auch Bibelunterricht in der Ketschua-Sprache erteilen. Durch Überschwemmungen wurde die Siedlung fast komplett zerstört und musste neu aufgebaut werden. Jim erlitt einen Malariaanfall und bekam die Folgen zu spüren: „Ich brachte es nicht fertig, auch nur zwei Sätze zu beten“.
Da auch die Missionsstation zerstört war, nutzten sie die Zeit zu einer Erkundungsfahrt in südlichere Gegenden, wo man tatsächlich auf eine große Familie stieß, die um die Gründung einer Schule bat. Jim und Elisabeth ließen sich dort als Pioniermissionare nieder.
Wie gut, dass Jim in seiner Studienzeit viel Gottes Wort gelesen hatte, denn jetzt im Missionsalltag war es schwierig mit gründlicher Bibellese: „Es kostet Mühe, sich freizumachen und Zeit herauszuschlagen, allein schon zum Lesen“.
Danach kehrten beide nach Shandia zurück, das mit vereinten Kräften (so half auch Jims Vater mit) wieder aufgebaut wurde. Der Herr segnete die Arbeit dort, es kamen Indianer zum Glauben, und am 30. Mai 1954 schreibt er: „Zum ersten Mal haben wir eine Abendmahlsfeier in ketschuanischer Sprache gehalten“, und am 17. Juli konnte er schon von 25 Teilnehmern berichten. Diese Feiern hatten einen bemerkenswert schlichten und zugleich tiefen Charakter: Ohne Predigt oder Belehrung wurden einfach Loblieder gesungen, und es wurde gebetet, „und die neu im Glauben Stehenden begriffen so allmählich, was Anbeten heißt und welchen Sinn es hat – schlicht und aufrichtig brachten sie dem Herrn die Liebe ihrer Herzen dar“.
Jim Elliot sah seine Missionarstätigkeit nicht als dauerhaft an, sondern begann früh, einheimische Brüder zu lehren, damit sie allmählich die geistliche Verantwortung übernehmen konnten.
„Gelder brauchen wir hier nicht, wirklich nicht, auch keine zusätzlichen Mitarbeiter. Wir brauchen Kraft des Geistes und seelische Stärke“.
Jim Elliot an seinen Bruder Bob
Der Große Auftrag: Die Aucas
Im September 1955 berichteten die beiden Missionspiloten Ed McCully und Nate Saint von einigen Aucahäusern, die nur wenige Flugminuten von Arajuno, dem Außenposten der Missionare, entfernt waren. Jim sah die Erfüllung seiner intensiven Gebete näher kommen: „Und das führt mich zu der anderen Frage, die ich so oft vor dich gebracht habe: die Aucas. O Herr, wer ist dieser Aufgabe gewachsen?“ „Mich von neuem dargeboten für die Arbeit bei den Aucas“.
Von einer geflüchteten Aucafrau lernten sie einige einfache Sätze, und dann begannen die Männer, die Auca-Siedlung zu überfliegen und dabei Geschenke abzuwerfen und ihnen einige Worte zuzurufen. So kamen erste Kontakte zustande. Jim war in großer Erregung. Seine Frau erinnert sich: „Wenn er mit Nate (Saint) von einem Aucaflug zurückkam, war er so erregt, dass er kaum etwas essen konnte – ich glaube, ich hätte ihm Heu vorsetzen können, er hätte nicht darauf geachtet“.
Elisabeth sah das Unternehmen nicht ohne Sorge und fragte zweifelnd, ob es Gottes Plan sei, sie schon so bald von der Arbeit unter den Ketschua-Indianern zu den Aucas zu senden. Doch Jim wollte, dass aus „jedem Stamm und Sprache und Nation“ Menschen zum Glauben kämen. Er sah sich jetzt gerufen, und so konnte auch Elisabeth ihrem Mann freudigen Herzens planen helfen.
Am 27.11.1955 flogen sie zum zweiten Mal zu den Aucas und erlebten, wie ein Mann aus diesem feindlich eingestellten Stamm ihnen zuwinkte. Jim betete: „O Herr, sende mich bald zu den Aucas“. Einige Zeit später entdeckte Nate Saint ein Sandufer an dem Curaray, dem Fluss in der Nähe der Siedlung, wo sie landen konnten. Ob jetzt der lang ersehnte Traum Wirklichkeit wurde?
Alle beteiligten Missionare und deren Frauen wussten um die Möglichkeit, dass Schlimmes geschehen könnte: „Wir begannen, von der Möglichkeit zu sprechen, dass er nicht zurückkehrt. ‚Wenn Gott es will, Liebste’, sagte Jim, ‚ich bin bereit, für die Aucas zu sterben’“. „Seinen Auftrag wollen wir ausführen, indem wir das Evangelium zu diesen Menschen bringen. Sie haben in ihrer Sprache nicht einmal ein Wort für Gott.“ Sie verlebten noch den Neujahrstag gemeinsam und verabschiedeten sich am . Januar: „Als er die Hand auf die Klinke legte, hätte ich beinahe laut gesagt: ‚Weißt du, dass du diese Tür vielleicht nie wieder aufmachen wirst?’“
Am 2. Januar landeten die fünf Missionare Jim Elliot, Nate Saint, Roger Youderian, Ed McCully und Peter Fleming in „Palm Beach“, Jim watete durchs Wasser zwei wartenden Frauen und einem Mann der Aucas entgegen – und nahm einen Auca an der Hand. Das Treffen verlief friedlich, so dass die fünf entschieden, sich einige Tage später nochmals dort einzufinden. Am Sonntag, den 8. Januar 1956 stiegen sie zum Flug auf, sahen, wie sich ca. 10 Aucas dem Ufer näherten, und landeten wieder an dem Sandufer. Doch in dem Aucadorf hatte der Dorfälteste nach der Heimkehr der drei ersten Aucas eine weit reichende Entscheidung getroffen: Die Fremden seien – wie alle Fremden in der Vergangenheit – zu töten. Er und vier weitere junge Männer traten aus dem Busch und töteten alle fünf Missionare, deren Leichen man später im Fluss fand. Obwohl diese alle Schusswaffen bei sich führten, hatten sie nur Warnschüsse abgegeben – sie hatten sich gegenseitig verpflichtet, die Waffen nicht gegen Menschen zu verwenden.
Märtyrerblut – Samen der Kirche
Das Leben der fünf Missionare fand ein jähes Ende. Doch damit hatte Gottes Wirken noch keineswegs aufgehört. Im Gegenteil, gerade die Tatsache, dass Jim Elliot und seine Freunde sich ohne Gegenwehr töten ließen, überzeugte die Aucas von ihren friedlichen Absichten. So konnte Elisabeth Elliot zusammen mit ihrer Tochter und mit Rachel Saint, der Schwester von Nate Saint, 1958 ungefähr ein Jahr in dem Dorf der Mörder der fünf Männer leben und die Auca-Sprache erforschen. Später segnete der Herr diesen Einsatz – alle fünf Mörder, Dyuwi, Kimo, Dawa, Gikita und Mincaye, bekehrten sich.
„Gott nahm fünf gewöhnliche junge Menschen von außergewöhnlicher Hingabe und benutzte sie zu seiner eigenen Verherrlichung. Sie hatten nie das Vorrecht bekommen, dem sie so enthusiastisch nachstrebten, nämlich den Huaorani von dem Gott zu erzählen, den sie liebten und dem sie dienten. Aber auf jeden Huaorani, der heute durch die Bemühungen anderer auf Gottes Weg kommt, kommen tausend Weiße, die Gott aufgrund ihres Beispiels treuer folgen. Den Erfolg, der ihnen im Leben versagt wurde, hat Gott vervielfacht und wird ihn vervielfachen zum Gedächtnis ihres Gehorsams und ihrer Treue“
Das Glaubensleben von Jim Elliot – und das seiner Freunde – sollte auf jeden von uns nicht ohne Eindruck bleiben. Auch 50 Jahre nach seinem Tod appelliert er an uns, unsere „Leiber Gott darzustellen als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer“ (Röm 12,1) – im täglichen Leben und in dem Teil des Reiches Gottes, in den Er uns gesetzt hat, um Frucht für Ihn zu bringen.
Kommentare
Nützliche Links
Elberfelder Übersetzung

Die Elberfelder Übersetzung Edition CSV ist eine wortgetreue Übersetzung der Bibel in verständlicher Sprache. Auf dieser Webseite können Sie den Bibeltext vollständig lesen und durchsuchen. Zudem werden Werkzeuge angeboten, die für das Studium des Grundtextes hilfreich sind.
www.csv-bibel.deDer beste Freund

Diese Monatszeitschrift für Kinder hat viel zu bieten: Spannende Kurzgeschichten, interessante Berichte aus anderen Ländern, vieles aus der Bibel, Rätselseiten, Ausmalbilder, Bibelkurs, ansprechende Gestaltung. Da Der beste Freund die gute Nachricht von Jesus Christus immer wieder ins Blickfeld rückt, ist dieses Heft auch sehr gut zum Verteilen geeignet.
www.derbestefreund.deIm Glauben leben

Diese Monatszeitschrift wendet sich an alle, die ihr Glaubensleben auf ein gutes Fundament stützen möchten. Dieses Fundament ist die Bibel, das Wort Gottes. Deshalb sollen alle Artikel dieser Zeitschrift zur Bibel und zu einem Leben mit unserem Retter und Herrn Jesus Christus hinführen.
Viele Artikel zu unterschiedlichen Themen - aber immer mit einem Bezug zur Bibel.
www.imglaubenleben.de